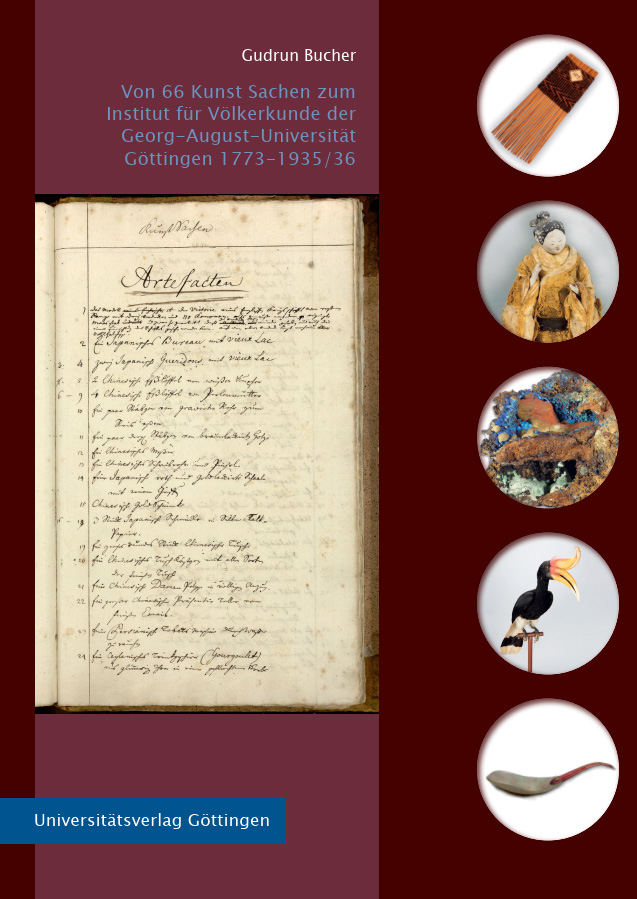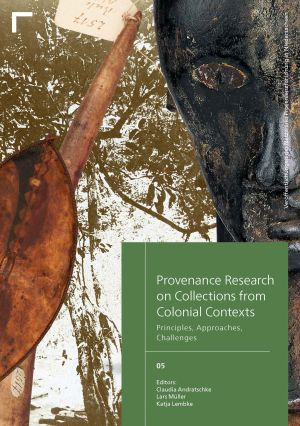Am Donnerstag begrüßen wir Prof. Dr. Christoph Antweiler von der Uni Bonn zum ersten Vortrag im Institutskolloquium Ethnologie Sommer 2024.
Termin: Donnerstag, 18.04.2024 / 16:00 Ct.
Ort: Theaterstraße 14
Gast: Prof. Dr. Christoph Antweiler, Institut für Orient- und Asienwissenschaften
Abstract: Für offene Kulturdebatten. Sieben Maximen für intersubjektiven und humanen Austausch
Der Vortrag macht ein Plädoyer für offene Debatten und gegen die Meidung von Konflikten im öffentlichen Austausch. Im Blick habe ich dabei vor allem Kontroversen über Kultur, Identität und Kolonialität. Ich wende mich gegen die derzeit gängige Polarisierung, Polemik und Personalisierung. Pauschale Breitseiten gegen Political Correctness, Cancel Culture, Woke-Ansätze oder Dekolonisierung der Forschung und Lehre bringen uns nicht weiter. Das sind mittlerweile alles Kampfbegriffe. Statt den beklagenswerten Zustand öffentlicher Debatten weiter zu beklagen, stelle ich sieben positive Maximen zur Verbesserung der Debattenkultur zur – gern kontroversen – Diskussion:
(1) Wissenschaft ist mehr als sog. westliche Wissenschaft. Wissenschaft beruht auf einer besonderen, aber universell verbreiteten Haltung zur Welt. (2) Diskussionsbeiträge sollten ausschließlich nach Schlüssigkeit und gesicherter Evidenz bewertet werden. (3). Jede/r sollte über jede/n sprechen dürfen; Diskussionspartner sind dabei grundsätzlich als Personen zu respektieren. (4) Wir sollten für die Anerkennung vielfältiger Lebensformen kämpfen, aber gegen Sonderrechte für bestimmte Kollektive, wenn solche Rechte Bürger- bzw. Menschenrechte verletzen. (5) Eine Übernahme von Ideen oder Symbolen, die aus anderen Kulturen stammen, muss keine Aneignung oder gar Enteignung sein. (6) Manche Wörter sollte man vermeiden, aber Verbote, bestimmte Wörter zu benutzen, sind konsequent abzulehnen. (7) Wir sollten das Wort „Rassismus“ nicht zum pauschalen Etikett verkommen lassen – gerade wenn wir uns als Antirassisten verstehen.